Quelle: eGovernment
Grau ist alle Theorie
Die Forderung nach mehr Open-Source-Lösungen in der öffentlichen Verwaltung ist unterstützenswert. Ein Abschied von proprietärer Software ist langfristig günstiger und fördert die digitale Souveränität. Doch so einfach ist es in der Praxis nicht, wie der IT-Verantwortliche der Gemeinde Fuldatal, Christian Grams, erklärt.
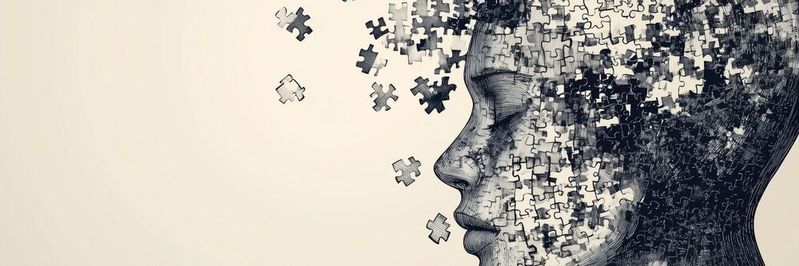
„Open Source ist grundsätzlich wünschenswert, und es kann sehr einfach ein Linux-Desktop hingestellt werden mit Open Office und fertig“, sagt Christian Grams. „Für die öffentlichen Verwaltungen funktioniert das aber nicht.“ Der IT-Verantwortliche für Fuldatal und eine IT IKZ (interkommunale Zusammenarbeit) mit drei weiteren Gemeinden spricht ein Thema an, das in der allgemeinen Debatte um Open Source oft untergeht: die Umsetzung in der Verwaltungspraxis.
Linux vs. Microsoft
Open Source höre sich auf dem Papier gut an, da es – bis auf den Support – kostenlos sei. „Aber die Architektur dahinter ist eine ganz andere als die, die aktuell in der Verwaltung hauptsächlich genutzt wird“, sagt Grams und meint damit natürlich Microsoft. „Die Anwendungen und auch Fachanwendungen, die wir betreiben, sind sehr, sehr Microsoft-lastig.“ Öffne beispielsweise ein Verwaltungsmitarbeiter in einer Fachanwendung ein Dokument, dann erwarte diese Anwendung meistens entweder ein PDF, ein Word- oder Excel-Dokument. „Das bedeutet, dass die Fachanwendungen Systemabhängigkeiten von Microsoft-Umgebungen haben“, betont Grams. Sie brauchen zum Beispiel die .NET-Infrastruktur oder die DLLs von Microsoft – „zwei Sachen, die derzeit faktisch noch nicht unter Linux abgebildet werden können“.
Die Fehler, die wir beim OZG gemacht haben, wiederholen wir jetzt bei Open Source.
Für den IT-Profi ist daher klar: „Bevor wir anfangen, zu überlegen, dass wir Open Source wollen – was grundsätzlich sinnvoll ist –, muss am besten auf EU-Ebene festgelegt werden, dass Hersteller ihre Software nicht nur für Microsoft oder vielleicht noch für Apple, sondern auch für Linux-Systeme bereitstellen müssen.“ Derzeit liege dieser Anteil erst bei knapp fünf Prozent.
Ein Software-Anteil von fünf Prozent zeigt: Open Source ist nach wie vor eine Nische. „Der normale Mitarbeiter kennt Linux nicht und wäre heillos überfordert“, ist Grams sicher. Open Source sei in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer eine Welt für Nerds und Geeks, also für absolute Profis und Bastler. Dass die öffentliche Verwaltung nun unbedingt ein solches Nischenprodukt wolle, hält Grams für bedenklich. Auch im Hinblick auf die Implementierung und Weiterentwicklung der Software: „Bei einem Betriebssystem wie Ubuntu ist mittlerweile auch eine Firma dahinter, aber die sind eher die Geldgeber. Die eigentlichen Entwickler, das ist die öffentliche Community.“
Und hier stößt das System an seine Grenzen, denn die sensiblen Daten der öffentlichen Verwaltungen erlauben es nicht, Bürger oder Mitarbeiter mal eben an die Applikation ranzulassen. „Das BSI würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen“, sagt Grams.
Lösung openDesk?
Mit „openDesk“ soll es nun eine Lösung für ebendiese Problematik geben. In der Arbeitsplatzlösung, die über das Zentrum für digitale Souveränität (ZenDiS) angeboten wird, sind verschiedene Open-Source-Komponenten unter einer gemeinsamen Oberfläche integriert. Die typischen Anwendungsfälle wie E-Mail- und Kalenderfunktion oder Videokonferenzen sollen hier abgedeckt werden – auf Open-Source-Basis. Ein richtiger Schritt, findet Grams, doch auch hier fehle die Anbindung der Fachanwendungen. „Wir haben hier immer noch die Inkompatibilität zwischen Linux- und Windows-Applikationen. Und zu 100 Prozent lassen sich die Applikationen nicht übernehmen.“
Welche Alternativen gibt es also? „Die einzige Möglichkeit, wie man so etwas sinnvoll für die öffentliche Verwaltung umsetzen kann, ist, dass entweder alle kommunalen Rechenzentren ihre Fachanwendungen auch für Open-Source-Lösungen kompatibel bereitstellen – was ein Riesenaufwand wäre –, oder die Anwendungen werden nicht mehr als vollwertige Client-Server-Anwendung bereitgestellt, sondern als Web-Applikation.“ Damit könne man aber nicht alle Fachanwendungen abbilden, zumal hier der Sicherheitsaspekt noch stärker in den Vordergrund rücke, da sensible Daten in Echtzeit über das Netzwerk gehen.
Eine echte Öffnung von Microsoft hin zu Open Source sieht Grams noch nicht. Zwar werde beispielsweise PowerShell auch für Linux angeboten – „aber wir sind noch weit davon entfernt, dass in der Fläche alles, was Microsoft anbietet, auch quelloffen genutzt werden könnte“. Im Gegenteil: Der US-amerikanische Konzern wolle seinen Kunden derzeit eher sein Cloud-Produkt „Microsoft 365“ aufzwingen.
In seiner eigenen Gemeinde und auch in anderen Kommunen hält Grams den Einsatz von Open-Source-Lösungen für „einfach nicht machbar“. Die Kompetenzen in den öffentlichen Verwaltungen hinsichtlich herkömmlicher Bürotätigkeiten seien bereits jetzt sehr schlecht. Ein komplett unbekanntes Betriebssystem und neue Applikationen würden die meisten komplett überfordern.
Know-how vermitteln
Der Grund: Es gibt keine Ausbildungen für neue Applikationen. Die Mitarbeiter würden zwar geschult, wenn beispielsweise geänderte rechtliche Rahmenbedingungen eine andere Vorgehensweise erfordern, doch für die IT-Nutzung gebe es „seit Ewigkeiten“ keine Schulung. „Wir haben einen sehr, sehr schlechten Bildungsstand, was allgemeine IT-Tätigkeiten anbelangt“, sagt Grams. Selbst beim Nachwuchs sieht es nicht besser aus: „Wir reden von Digitalisierung, aber die jungen Leute kriegen nicht mal vernünftig einen PC bedient.“ Hier fehle es bereits an den Grundlagen. Schuld daran sei auch das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung und die daraus resultierende Forderung, die eigenen Leute selbst auszubilden. Grams: „Die Frage ist nur: wann und mit welchem Geld?“ Das Resultat: Die Mitarbeitenden sollen immer mehr leisten, haben aber immer weniger Zeit und sind nicht effizient in ihrem Arbeiten, sodass sie noch weniger Zeit haben. „Es ist ein Teufelskreis“, fasst Grams zusammen.
Für die Gemeinde Fuldatal wurde inzwischen ein eigener Schulungsraum eingerichtet. Grams selbst will hier Grundlagenschulungen anbieten, um die normalen Bürotätigkeiten – wie beispielsweise den Bau einer Tabelle – zu optimieren. Doch nicht jede Kommune hat eine solche Möglichkeit. „Alle Kommunen, die unter 20.000 Einwohner haben, haben kein Fach-IT-Personal, sondern haben einen Verwaltungsfachangestellten, der sich dafür zuständig fühlt“, erklärt Grams. Eigentlich müsse es die klare Vorgabe geben, dass in jeder Kommune mindestens ein fachlich ausgebildeter ITler vorhanden sein müsse. „Aber die haben wir nicht“, sagt Grams.
Um aber Open-Source-Anwendungen sicher und effizient in Kommunen einsetzen zu können, braucht es fachliche Kompetenzen. Eine gesetzliche Vorgabe für mehr Open Source in der öffentlichen IT sei daher, auch vor dem Hintergrund der schwierigen Anbindung von Fachanwendungen, laut Grams kaum umsetzbar. „Die Fehler, die wir beim OZG gemacht haben, wiederholen wir jetzt bei Open Source“, sagt er. Statt im Prozessmanagement sei die Verwaltung derzeit noch im Produktmanagement verortet, zudem gebe es keine vernünftigen, klaren Strukturen und Prozesse hinsichtlich der OZG-Umsetzung.
Besser Vor- als Nachsicht
Für Open Source in der Verwaltung heißt das: bei den Grundlagen anfangen. Grams: „Die Hersteller müssen erst mal die Voraussetzungen schaffen, dass ihre Applikationen unter Open-Source-Lösungen funktionieren.“ Dies klappe, wie erwähnt, wohl nur mit einer gesetzlichen Verpflichtung, denn von selbst würden die Hersteller das nicht machen, „denn das ist ja ein Entwicklungsaufwand“ und dieser koste Geld. Dabei sei die Entwicklung für verschiedene Betriebssysteme durchaus machbar – allerdings nicht, wenn sie erst nachträglich geschehe. Und genau in dieser Situation befinden sich die Fachanwendungen, die ja bereits existieren.
Dennoch: Den Schritt in Richtung digitale Souveränität und Resilienz hält auch Grams für absolut wichtig. Und genau aus diesem Grund findet er es schwierig, Applikationen, die mit sensiblen Daten hantieren, quelloffen zu veröffentlichen. Beispiel: das Auslesen eines Personalausweises. „Da gibt es sehr viele technische Sicherheitsmerkmale, die niemals open source sein können“, sagt Grams, und findet dies auch richtig, denn sonst könnten diese Sicherheitsmerkmale theoretisch umgangen werden. Deshalb sei auch das Thema digitale Identität im OZG noch lange nicht geklärt.
Um den Kommunen bei OZG und Open Source unter die Arme zu greifen, schlägt Grams ein Landkreis-weites IKZ vor. Dies wäre kosteneffizient und fördere standardisierte Prozesse. „Aus meiner Sicht sollte man die gesamte IT-Kompetenz in den Landkreis auslagern“, sagt Grams, „sodass wir alle die gleichen Anwendungen nutzen und die gleichen Systeme haben. Dann können wir auf eine vernünftige, effiziente Art und Weise die Digitalisierung weiter vorantreiben“.
